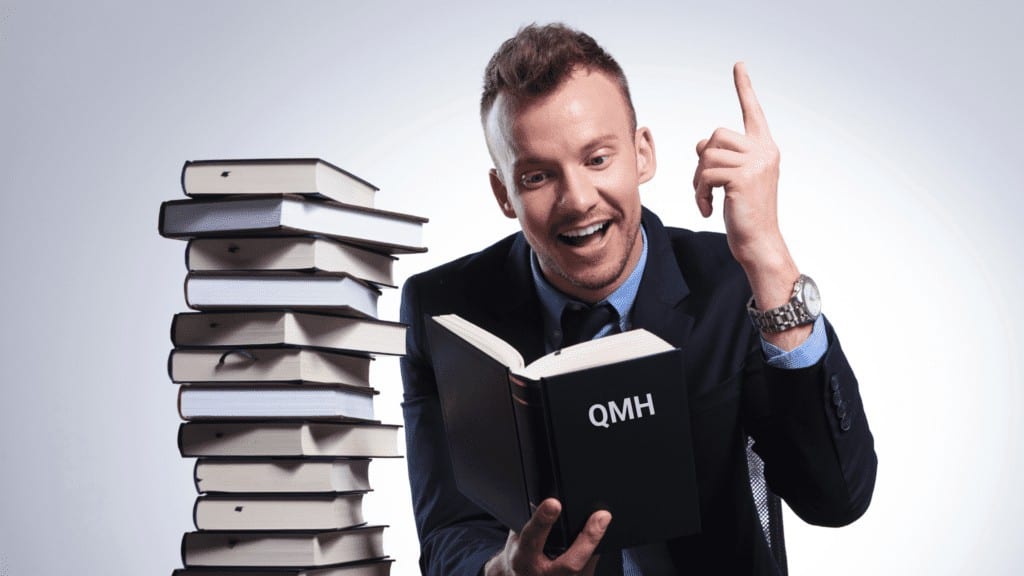Lebendiges QM-System
Wie erleben eigentlich Mitarbeiter die unterschiedlichen Reifegrade von Managementsystemen? Hierzu betrachten wir die beiden Extremfälle, wohl wissend, dass es dazwischen unendliche Varianten gibt.
Extremfall 1: Ein QMB macht alles für die ISO 9001-Pappe an der Wand
Führungskräfte und Mitarbeiter erhalten dokumentierte Vorgaben, die sich mit den aktuellen Rahmenbedingungen nur schwer umsetzen lassen. Zu einzelnen Themen ist den Mitarbeitern klar, dass diese sinnvoll gemanagt werden müssen. So ist z. B. schon klar, warum Messmittel geeignet sein müssen, Lieferanten zu bewerten sind oder die Kompetenz der Mitarbeiter entwickelt werden sollte. Jedoch passen die festgeschriebenen Vorgaben nicht zu den aktuell gelebten Prozessen. Die blöden Aufkleber an den Messmitteln gehen ständig ab, das Ergebnis der ABC-Analyse der Lieferanten liefert keinen Mehrwert und die Qualifikationsmatrix samt Schulungsplan werden pflichtbewusst vor jedem Zertifizierungsaudit aktualisiert.

Extremfall 2: Alle QM-Aktivitäten und Dokumente erfüllen einen Zweck
Prozessverantwortliche nehmen sich regelmäßig Zeit, um ihre Prozesse auf Sinnhaftigkeit zu hinterfragen, Optimierungsmöglichkeiten zu finden und ein Gespür für die aktuelle gelebte Praxis zu erhalten. Hierbei werden betroffene Mitarbeiter selbstverständlich in Prozess-Workshops eingebunden.
QMBs und Beauftragte anderer Managementsysteme sowie Experten werden einbezogen, um Anforderungen von Kunden, aus Gesetzen oder Normen zu verstehen und angemessen zu berücksichtigen.
Wenn Prozessanpassungen Auswirkungen auf andere Prozesse haben könnten, nehmen sich die entsprechenden Prozessverantwortlichen mit ihren Mitarbeitern die Zeit, um eine für das Unternehmen optimale Lösung zu erarbeiten.
Ergebnisse werden nicht nur dokumentiert, sondern auch adäquat kommuniziert. Teils kann eine Mitteilung ausreichen, jedoch ist auch ein umfassendes Schulungsprogramm für die Mitarbeiter denkbar.
Kosten und Nutzen sowie Risiken und Chancen werden gleichrangig betrachtet. Der spürbare Kundennutzen und der langfristige wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens bilden die Grundlage für Entscheidungen der Geschäftsführung.

Was hält Unternehmen ab?
Es gibt mehrere und teils nachvollziehbare Faktoren, warum der „Extremfall 2“ selten anzutreffen ist.
Faktor Zeit: Insbesondere in KMUs sind Führungskräfte stark in das Tagesgeschäft eingebunden. Statt am Prozess zu arbeiten, arbeiten sie tagtäglich in den Prozessen. Überlagert wird dieser Umstand durch fast tägliche Feuerwehraktionen. Nach dem Motto „Wir haben keine Zeit, den Zaun zu reparieren, wir müssen Hühner fangen“ sind die Führungskräfte fleißig damit beschäftigt, wiederkehrend die gleichen Probleme zu bekämpfen.
Faktor Prioritäten: Die Prioritäten sind sehr eng mit dem Faktor Zeit verknüpft. Denn wer sagt, er habe jetzt keine Zeit, findet aktuell etwas anderes einfach wichtiger. Termindruck von Kunden, Chefprojekte, eine zu hohe Arbeitslast oder akute Probleme führen dazu, dass Führungskräfte nach Feierabend auf ihre geplanten Aktivitäten schauen, nur um festzustellen, dass kein Punkt abgehakt ist. Jedoch verlief der Tag ohne Langeweile und sogar für die Mittagspause war heute einfach keine Zeit.
Solange die Arbeit am Prozess nicht die gleiche Priorität genießt wie die Arbeit im Prozess, samt notwendiger Feuerwehraktionen, wird sich daran wenig ändern.
Faktor oberste Leitung: In der ISO 9001 wird der Begriff „oberste Leitung“ verwendet, da diese Position je nach Organisationsstruktur und Anwendungsbereich der Zertifizierung von Personen oder Gremien mit unterschiedlichen Bezeichnungen besetzt sein kann. In diesem Buch wird meistens die Geschäftsführung erwähnt, wobei auch ein Vorstand oder ein Abteilungs- oder Niederlassungsleiter die oberste Leitung bilden kann.
Die Werte, das Auftreten und die Kommunikation der obersten Leitung haben wahrscheinlich den größten Einfluss. Sie gestalten meist unbewusst die Kultur der Organisation. Führungskräfte und Mitarbeiter erleben, wie mit Problemen umgegangen wird oder wie sie auf Vorschläge reagieren. Schnell wird gelernt, welches Verhalten scheinbar gewünscht ist, und man passt sich an. Man beteiligt sich an der Suche nach Verursachern von Fehlern, statt Ursachen zu ermitteln und abzustellen. Wer zweimal mit Vorschlägen vor die Wand läuft, nimmt selten einen dritten Anlauf.
Der Fisch stinkt vom Kopf, sagt der Volksmund.
Faktor Zertifizierung: Durch den Wunsch, die Qualität über ein Zertifikat nachzuweisen, darf der Einfluss von Erlebnissen im Rahmen von Zertifizierungsaudits nicht unerwähnt bleiben.

Rezept für den Weg zum lebendigen Managementsystem
Ob eine Zertifizierung gewünscht ist oder nicht: QM-Systeme können besser zu lebendigen Systemen reifen, wenn Klarheit zu den Prioritäten und Zielen der Organisation besteht. Die ISO 9001 verwendet hierfür die Begriffe Qualitätspolitik und Qualitätsziele.
Lest die Qualitätspolitik durch und reflektiert, woran ein unsichtbarer Geist beobachten könnte, dass eure Mitarbeiter die Qualitätspolitik im alltäglichen Handeln leben. Dies sowie die umgekehrte Frage können zu einer spannenden Teamübung werden, um Verbesserungspotenziale zu identifizieren.
Statt der typischen Hohlphrasen zur Kundenzufriedenheit und der kontinuierlichen Verbesserung sollte die Qualitätspolitik ein echtes Leitbild sein, an dem Mitarbeiter sich und ihr Handeln messen können.
Wenn z.B. in diesem Leitbild steht, dass Führungskräfte ein Drittel ihrer Zeit für die Arbeit an den Prozessen nutzen und Mitarbeiter bei der Gestaltung einbinden sollen, dann ist das nur von Wert, wenn die oberste Leitung den Führungskräften vertraut und die erforderlichen Ressourcen (Zeit, Räume und Geld für Investitionen) bereitstellt.
Vertrauen ist nicht mit blindem Vertrauen zu verwechseln. Interesse und der Austausch zu aktuellen Verbesserungsprojekten (= Kontrolle) sind eine wichtige Form der Wertschätzung für Führungsarbeit.
Über eine durchdachte interne Kommunikation über Ziele und Ergebnisse wissen die oberste Leitung, Führungskräfte und Mitarbeiter, welche Prioritäten aktuell gelten. Die meisten Aktivitäten orientieren sich an den übergeordneten (Qualitäts-)Zielen und stehen in Zusammenhang mit Kundenzufriedenheit sowie nachhaltigem Unternehmenserfolg.
Mitarbeiter merken, dass bei Problemen nicht der Schuldige gesucht, sondern Ideen zur Vermeidung eines Wiederauftretens gefragt sind. Sie können ihre Gedanken und Vorschläge ohne Angst einbringen.
Arbeit bleibt Arbeit, aber sie kann durchaus Spaß machen. Wenn Ideen ausprobiert werden und funktionieren, sind die Beteiligten stolz auf das Arbeitsergebnis. Gehört zu werden, sich einbringen zu dürfen und positive Veränderungen zu erfahren, erfüllt grundlegende Bedürfnisse.
In einem lebendigen Managementsystem erleben Mitarbeiter, dass ihr Einsatz etwas bewirkt. Wäre das nicht ein erstrebenswertes Ziel?